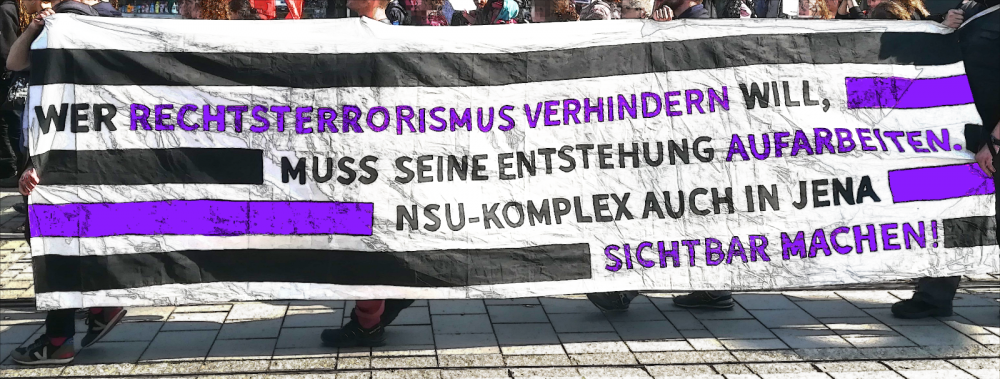Beitrag „NSU-Komplex auflösen Jena“ Enver Şimşek-Platz, Klang der Stolpersteine 09.11.22
Ich wünsche allen Anwesenden einen guten Abend. Ich spreche heute für die Gruppe „NSU-Komplex auflösen Jena“. Wir sind seitens der Bonhoeffer-Gemeinde und KoKont angefragt worden einen kurzen Redebeitrag zu halten. Gerne möchten wir dies tun.
Ich will offen sein, wir hatten durchaus Zweifel, ob dieser Ort – der Enver Şimşek-Platz – der richtige Ort sein kann, um am 9.11, dem Jahrestag der Novemberpogrome 1938, den Opfern des Nazi-Terrors zu gedenken. Denn sollte dieser Tag nicht dem Andenken an die Opfer eben dieser antisemitischen Pogrome sowie den Opfern der folgenden Deportationen, also den Opfern der Shoa gewidmet sein?
Einerseits ist es ohne Frage wichtig den Opfern des National-Sozialistischen Untergrundes (NSU) zu gedenken, also jenen, die von dieser rechten Terrorgruppe, welche in 1990er Jahren hier in Jena entstand, verletzt oder getötet wurden. Und Enver Şimşek war ihr erstes Todesopfer. Andererseits gilt aber auch: Wenn wir heute, am 9.11, hier stehen und gedenken, dann aus zwei Gründen: Erstens wurde Enver Şimşek von Nazis umgebracht, von neuen Nazis oder auch Neo-Nazis. Und es gibt viele Bezüge dieser Nazis zum historischen Nationalsozialismus. Und zweitens spielte auch der Antisemitismus in der Ideologie des NSU eine wichtige (wenn auch oft übersehene) Rolle. Bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich aber etwas zu Person von Enver Şimşek sagen (hierbei erlaube ich mir teilweise auf einen Text zurückzugreifen, der zu seinem Todestag beim Gedenken vor der JG in der Johannisstraße von Konrad Erben verfasst und verlesen wurde):
Enver Şimşek kam 1985 aus der Türkei nach Deutschland. Er arbeitete zunächst in einer Fabrik. Nach Feierabend brachte er sich selbst das Blumenbinden bei, verkaufte die Sträuße am Wochenende am Straßenrand. Später machte er sich dann mit einem Blumenhandel selbstständig. Daraus entstand ein Blumengroßhandel mit angeschlossenen Läden und Ständen. Mit den Erlösen unterstützte Enver Şimşek auch sein Heimatdorf in der Türkei, wenn ein Brunnen gebaut oder die Schule renoviert werden musste. Semiya Şimşek beschreibt ihren Vater Enver als liebevoll und betonte, dass er seine Kinder zur Selbstständigkeit erzog.
Dann kommt der 09. September 2000, Enver Şimşek verlädt an diesem Tag Blumen und baut seinen Verkaufsstand an einer Straße in Nürnberg auf. Er ist an diesem Tag nur zufällig vor Ort. Eigentlich würde einer seiner Angestellten hier verkaufen, aber der ist im Urlaub. Gegen Mittag tauchen die Neonaziterroristen des NSU auf, Enver Şimşek befindet sich gerade im Inneren seines Transporters. Sie feuern acht Schüsse auf ihn. Zwei Tage später erliegt er seinen Verletzungen. Enver Şimşek war die erste von mindestens zehn vom NSU ermordeten Personen. Er wurde 39 Jahre alt und hinterließ seine Frau Adile Şimşek und die beiden Kinder Semiya und Abdulkerim Şimşek. In der Folge wird die Familie von der Polizei verdächtig selbst etwas mit dem Mord zu tun gehabt zu haben. Das gleiche passierte in den kommenden Jahren auch noch vielen weiteren Angehörigen der Mordopfer des NSU. Sie wurden von den Sicherheitsbehörden jahrelang schikaniert und in den Medien falschen Verdächtigungen ausgesetzt. Bis sich der NSU 2011 selbst enttarnte. Bis heute sind die Taten nicht restlos aufgeklärt.
Die Mörder von Enver Şimşek – die Terroristen des NSU – bezogen sich in ihren Taten auch auf den historischen Nationalsozialismus, wie nicht nur ihr Name: Nationalsozialistischer Untergrund, bereits verdeutlicht. Auch verkauften sie aus dem Untergrund heraus ein zynisches Brettspiel mit dem Namen „Pogromoly“, welches die Shoa verherrlicht. Vor dem Untertauchen störten und schändeten sie die KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Ihr politisches Umfeld leugnete den Holocaust. Somit ist nicht zuletzt der Antisemitismus im NSU-Komplex zu betonen, wie auch eine Tat vor genau 27 Jahren beweist: Am 9. November 1995 wird in Jena eine Puppe entdeckt, die an einem Fernwärmerohr aufgehängt und mit einem gelben Stern versehen ist. 1996 hängt eine ähnliche Puppe auf einer Autobahnbrücke über der A4, zusammen mit einer Bombenattrappe. Anlass ist der Besuch des damaligen Präsidenten des Zentralrats der Juden Ignatz Bubis. Beide Taten werden dem späteren NSU zugerechnet. Auf der Feindesliste des NSU fanden sich ferner 233 jüdische Einrichtungen als mögliche Anschlagsziele. Beate Zschäpe, eine der Terroristen, soll im Mai 2000 (ein halbes Jahr vor dem ersten Mord des NSU) erkannt worden sein, als sie die Synagoge Rykestraße in Berlin ausspähte. André Eminger, ein verurteilter Unterstützer des Kerntrios, hat sich „die Jew die“ – „stirb Jude, stirb“ – tätowieren lassen.
Warum es keine jüdischen Todesopfer des NSU gab, ist unbekannt. Der Antisemitismus der alten und neuen Nazis jedoch ist unstrittig und der Faschismus auch heute wieder eine reale Gefahr. Nutzen wir also den heutigen Tag, um an die Opfer der Novemberpogrome 1938 zu erinnern und zu mahnen. Der NSU ist leider nur ein Beispiel dafür, dass auch in der Gegenwart Rassismus und Antisemitismus als tödliche Gewalt fortwirken und wir dem entgegentreten müssen.